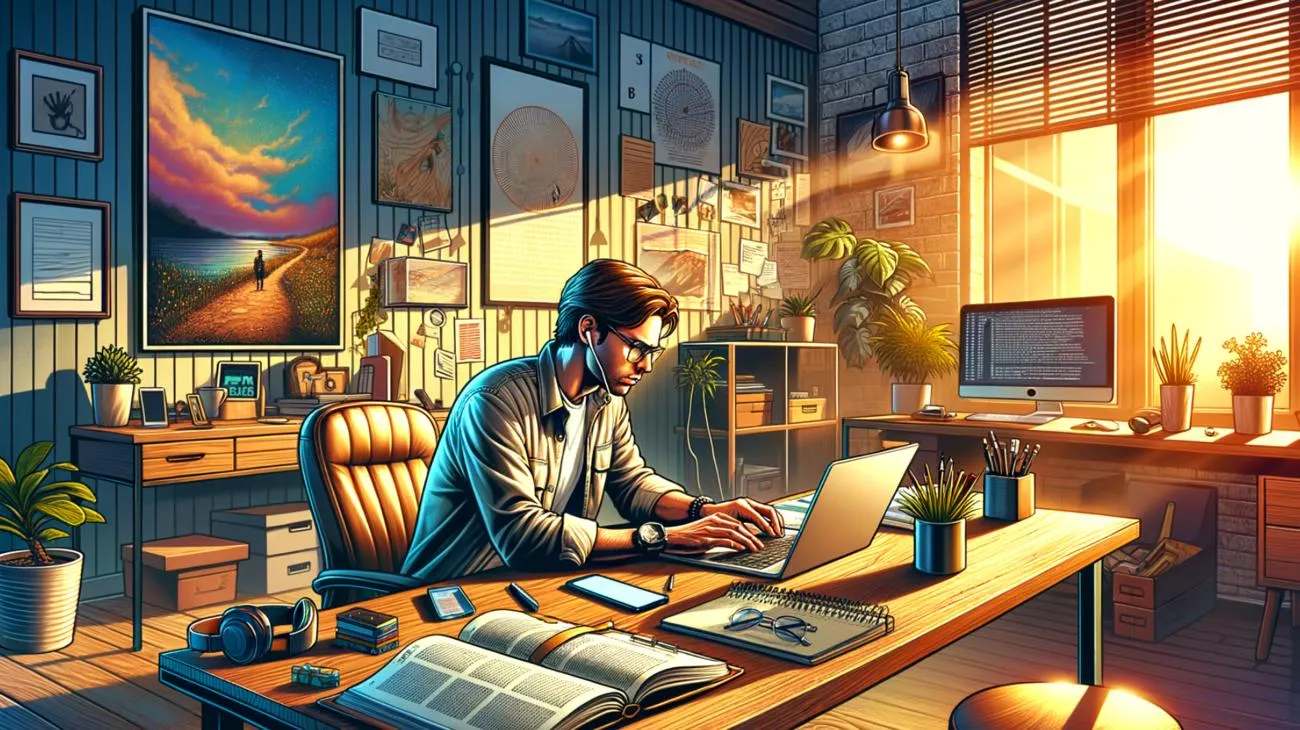Warum Multitasking nicht funktioniert – und was das mit deinem Gehirn macht
Stell dir vor, du schreibst gerade eine E-Mail, als eine WhatsApp-Nachricht aufpoppt, im Hintergrund der Fernseher läuft und das Telefon klingelt. Viele Menschen glauben, sie könnten problemlos mehrere Dinge gleichzeitig erledigen, doch die Wissenschaft zeigt ein anderes Bild. Unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, mehrere kognitiv anspruchsvolle Aufgaben gleichzeitig zu verarbeiten. Stattdessen wechselt es blitzschnell von einer Aufgabe zur nächsten – was messbare Nachteile mit sich bringt.
Aber es gibt gute Nachrichten: Wenn du verstehst, warum das so ist, brauchst du dich nicht selbst zu geißeln, wenn du nicht alles gleichzeitig schaffst. Im Gegenteil: Du kannst Wege finden, deutlich fokussierter, produktiver und entspannter zu leben.
Was ist Multitasking eigentlich?
Im Alltag bezeichnen wir vieles als Multitasking, aber wissenschaftlich betrachtet gibt es zwei verschiedene Formen:
- Echtes Multitasking: Zwei Aktivitäten laufen wirklich gleichzeitig ab – zum Beispiel Gehen und gleichzeitiges Sprechen. Das funktioniert gut, wenn mindestens eine der Tätigkeiten automatisiert ist.
- Task-Switching: Der schnelle Wechsel zwischen mehreren Aufgaben, wie es oft im Büro oder beim Smartphone-Gebrauch passiert. Wir glauben, Dinge parallel zu tun, doch in Wahrheit wechseln wir ständig den Fokus – mit mentalen Kosten.
Während echtes Multitasking bei automatisierten Vorgängen gut funktioniert, führt das ständige Hin- und Herschalten zwischen anspruchsvollen Tätigkeiten zu kognitiver Überlastung.
Der Mythos vom multitaskingfähigen Gehirn
Eine Studie der Stanford University aus 2009 zeigte ernüchternde Ergebnisse: Menschen, die sich als besonders multitaskingfähig betrachten, schnitten bei Tests zur Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit und Planung schlechter ab als diejenigen, die sich auf einzelne Aufgaben konzentrierten.
Je mehr sich jemand für einen „guten“ Multitasker hielt, desto schlechter schnitt er in Wahrheit ab. Dieses paradoxe Ergebnis lässt sich teilweise mit dem Dunning-Kruger-Effekt erklären: Menschen überschätzen oft ihre Fähigkeiten in Bereichen, in denen sie wenig Kompetenz haben.
Was passiert wirklich in deinem Gehirn?
Der präfrontale Kortex – verantwortlich für Denken, Entscheiden und Problemlösen – verarbeitet komplexe Informationen immer nur schrittweise. Statt echter Parallelverarbeitung kommt es zu ständigen Wechseln zwischen den Aufgaben.
Der Flaschenhals im Kopf
Forscher bezeichnen dieses begrenzte Verarbeitungssystem als „central bottleneck“, also den zentralen Flaschenhals. Nur eine komplexe Aufgabe kann bewusst bearbeitet werden, während die anderen warten müssen. Das erklärt, warum es bei der gleichzeitigen Bearbeitung ähnlicher Aufgaben – vor allem sprachlicher oder gedanklicher Natur – zu Effizienzverlusten kommt.
Die Kosten des Task-Switching
Der Wechsel zwischen Aufgaben ist nicht kostenlos: Jedes Umschalten benötigt mentale Energie und Zeit. Diese sogenannten „Switch Costs“ betragen zwar nur Millisekunden, summieren sich jedoch zu real spürbaren Produktivitätsverlusten im Tagesverlauf.
Eine Studie der Carnegie Mellon University zeigte, dass bereits das bloße Klingeln eines Telefons die Leistungsfähigkeit bei Denkaufgaben um bis zu 37 Prozent vermindern kann – selbst wenn das Gespräch nicht angenommen wird. Unser Gehirn reserviert automatisch Ressourcen, um auf das Signal reagieren zu können.
Die versteckten Kosten des Multitasking
Mehr Fehler, weniger Qualität
Multitasking macht uns nicht nur langsamer, sondern auch fehleranfälliger. In einer Studie der University of London bewältigten Teilnehmer eine Aufgabe unter E-Mail-Einfluss – mit dem Ergebnis: Ihr Intelligenzquotient sank temporär um durchschnittlich 10 Punkte. Zum Vergleich: Der kurzfristige Einfluss von Marihuanakonsum reduzierte den IQ nur um etwa vier Punkte.
Besonders tückisch: Viele unserer Flüchtigkeitsfehler beim Multitasking bemerken wir nicht. Das Risiko für Fehlentscheidungen und vergessene Details steigt deutlich.
Stress und Erschöpfung
Ständiges Wechseln zwischen Aufgaben aktiviert unser Alarmsystem: Cortisol und Adrenalin steigen. Kurzfristig sorgt das für Wachsamkeit, langfristig aber für Symptome wie chronische Erschöpfung, Reizbarkeit und Konzentrationsstörungen.
In einer vielbeachteten Studie der University of California, Irvine wurde festgestellt, dass es im Schnitt 23 Minuten und 15 Sekunden dauert, bis jemand nach einer Unterbrechung wieder zur ursprünglichen Aufgabe zurückfindet. In einem Arbeitsalltag voller Ablenkungen ist echte Konzentration somit oft unerreichbar.
Warum wir trotzdem nicht aufhören können
Trotz all dieser negativen Effekte fällt es uns schwer, mit dem Multitasking aufzuhören. Der Grund liegt tief in der Biologie: Immer wenn wir eine kleine Aufgabe abschließen – eine Nachricht beantworten oder eine Mail verschicken – schüttet das Gehirn Dopamin aus. Dieses belohnungsbezogene Glücksgefühl sorgt dafür, dass wir weitermachen wollen.
Die Illusion der Produktivität
Multitasking vermittelt das Gefühl, ständig produktiv zu sein. Doch das ist eine Illusion. In Wahrheit verbringen wir viel Zeit damit, den Fokus neu zu finden und Fehler zu korrigieren. Es ist, als würde man mehrere Kochtöpfe gleichzeitig überwachen – aber am Ende schmeckt kein Gericht richtig.
Die Ausnahmen von der Regel
Automatische vs. kontrollierte Prozesse
Was funktioniert: Wenn eine oder mehrere Aufgaben völlig automatisiert sind, beispielsweise Gehen, Atmen oder Schalten beim Autofahren nach jahrelanger Routine. Diese Tätigkeiten beanspruchen kaum bewusste Aufmerksamkeit und lassen sich gut mit Gesprächen oder Denkprozessen kombinieren.
Verschiedene Sinneskanäle
Auch wenn unterschiedliche Sinneskanäle angesprochen werden, kann paralleles Arbeiten teilweise funktionieren. Beispielsweise funktioniert bei vielen Menschen das Musikhören ohne Text während des Lesens. Sobald aber beide Tätigkeiten denselben Kanal beanspruchen – etwa Lesen und gleichzeitiges Hören von Sprache – kommt es zum Flaschenhals.
Strategien für mehr Fokus im Alltag
Single-Tasking als neue Superkraft
Statt Multitasking hilft bewusste Konzentration – das sogenannte Single-Tasking. Eine effektive Methode: die Pomodoro-Technik. Dabei arbeitest du 25 Minuten ungestört an einer Sache, gefolgt von 5 Minuten Pause. Diese Struktur verbessert die Aufmerksamkeit, reduziert Stress und erhöht die Qualität deiner Arbeit.
Die Umgebung optimieren
Ein zentraler Schritt ist das Eliminieren von Störfaktoren: Smartphone in einen anderen Raum legen, Benachrichtigungen ausschalten, alle unnötigen Browser-Tabs schließen. Je weniger Reize dein Gehirn parallel verarbeiten muss, desto besser funktioniert dein Fokus und deine Leistung.
Bewusste Pausen einbauen
Nach jeder intensiven Arbeitseinheit ist es hilfreich, kurz durchzuatmen. Das erlaubt deinem Gehirn, das Bearbeitete abzuspeichern und sich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Eine solche Arbeitsweise verbessert nicht nur das Ergebnis, sondern beugt auch mentaler Erschöpfung vor.
Die Zukunft unserer Aufmerksamkeit
In einer Welt voller Ablenkungen wird Aufmerksamkeit zur Superkraft. Wer es beherrscht, seinen Fokus zu steuern, hat im Beruf und im Privatleben einen echten Vorteil. Die Neurowissenschaft ist klar: Unser Gehirn liebt Klarheit und keine Reizüberflutung. Wer die Wahrheit über Multitasking kennt und entsprechend handelt, lebt produktiver, ausgeglichener – und mit viel weniger Stress.
Jetzt ist der perfekte Moment, das auszuprobieren. Schließe alle Ablenkungen aus, konzentriere dich auf eine einzige Aufgabe – und entdecke, wozu dein Gehirn wirklich fähig ist.
Inhaltsverzeichnis